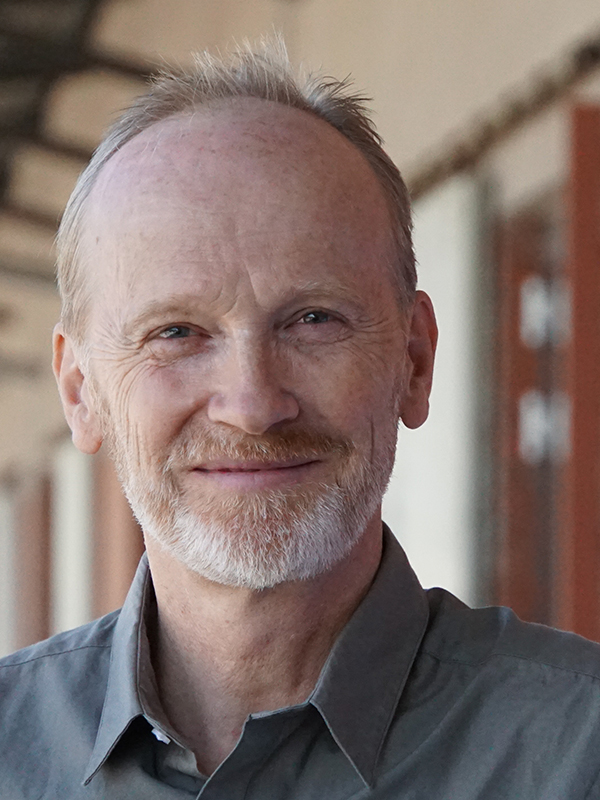Referent:innen
Seiteninhalt
Panel 1 – Ländlicher Raum, Ehrenamt, Erinnerungskulturen, lokale Projekte
Panel 2 – Regionale Identitäten, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung, Tourismus
Panel 3 – Innovation, Transformation, Orte der Zukunft, Land der Ideen
Zur Übersicht Forum Programm Vitas als PDFKEYNOTE
Dr. Julia Gabler ist Soziologin und kommt vom Meer. Sie arbeitet und forscht zur ländlichen Gesellschaft mit Fokus auf Ostdeutschland am TRAWOS Institut (u.a. zu geschlechtersensibler Regionalentwicklung und Strukturwandel in der Lausitz). Sie leitete das Institut von 2022-2025.
Zuletzt lehrte Gabler als Vertretungs-Professorin im Master Management Sozialen Wandels an der Hochschule Zittau/Görlitz.
Seit 2022 arbeitet und forscht sie mit dem Künsterkollektiv Recherchepraxis und ist im Vorstand des Kühlhaus Görlitz e.V.
Dr. Marion Steiner, geboren 1975 im Ruhrgebiet, studierte Kulturgeographie, Geopolitik in Berlin, Paris und Weimar. Seit 2005 ist sie Mitglied der TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) und seit 2025 deren Präsidentin.
Im Laufe ihrer beruflichen Laufbahn war sie an Welterbe-Initiativen ehemaliger Kohlebergbauregionen in Frankreich, Deutschland und Chile beteiligt. Von 2011 bis 2015 war sie Koordinatorin des Berliner Zentrum Industriekultur (bzi), von 2016 bis 2018 im Referat Industriekultur beim Regionalverband Ruhr RVR zuständig für internationale Beziehungen und Welterbe-Projekte. 2018 bis 2022 außerordentliche Professorin an der Katholischen Universität von Valparaíso, Chile.
Sie interpretiert das globale industrielle Erbe an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, lokalen Gemeinschaften und regionaler Politik.
PANEL 1
LÄNDLICHER RAUM, EHRENAMT, ERINNERUNGSKULTUREN, LOKALE PROJEKTE
Dr. Julia Dünkel ist seit 2023 Geschäftsführerin der Wismut Stiftung gGmbH. Das aktuell fünfköpfige Unternehmen mit Sitz in Chemnitz wurde 2021 gegründet und ist vom Bund sowie den Freistaaten Sachsen und Thüringen beauftragt, das vielfältige und ambivalente Wismut-Erbe zu bewahren, zu präsentieren, zu vermitteln und seine Erforschung anzuregen.
Zuvor war sie als Fachbereichsleiterin für Finanzen und Kultur zugleich Stadtkämmerin der Stadt Pößneck, verantwortete projektleitend u.a. das inhaltlich-museale Entstehen des Museum642-Pößnecker Stadtgeschichte und die Leitausstellung Erlebnis Industriekultur – Innovatives Thüringen seit 1800 zum Thüringer Themenjahr 2018.
Als Diplom-Volkswirtin promovierte sie 2006 mit wirtschafts- und sozialgeschichtlichem Schwerpunkt mit der unternehmenshistorischen Dissertationsschrift „Johann Bernhard Hasenclever & Söhne. Großkaufleute zu frühindustrieller Zeit, 1786-1870“. Sie ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt in Jena.
Olaf Raabe, geboren 1965 in Leipzig, studierte nach dem Abitur 1983 an der Hochschule für Musik in Leipzig im Fach Violine. Seit 1986 ist er Violinist in der Staatskapelle Halle.
Seit der Gründung des Vereins „Freunde der Halle-Hettstedter Eisenbahn e.V.“ 2007 ist er dessen Vorsitzender. Der Verein hat unter anderem das Ziel, zwei erhaltene Streckenabschnitte zwischen Halle/Saale und Hettstedt dieser ehemals wirtschaftlich bedeutendsten regelspurigen Privatbahn in Deutschland für einen musealen und Ausflugsverkehr zu reaktivieren.
2023 wurde Olaf Raabe stellvertretender Vorsitzender der lokalen Aktionsgruppe „Unteres Saaletal und Petersberg“ der Förderinitiative „Leader“. Seit 2024 ist er Beauftragter für Industriekultur des Fördervereins Planetarium Halle/Saale.
Anik Kompalla koordiniert seit 2021 im Burgenlandkreis die Sparte Industriekultur und gestaltet dort Schnittstellen zwischen Kultur, Tourismus, Wirtschaft und Strukturwandel.
Aktuell ist sie bei der SEWIG tätig, wo sie industriekulturelle Projekte strategisch weiterentwickelt. Zuvor leitete sie die Brikettfabrik Herrmannschacht in Zeitz, die als Brikettfabrik mit dem weltweit ältesten erhaltenen maschinellen Bestand ein bedeutendes Denkmal der Montanindustrie ist.
Mit über zehn Jahren Erfahrung und einem weiten Netzwerk engagiert sie sich für die nachhaltige Nachnutzung von Industriedenkmälern sowie -landschaften, die Einbindung regionaler Akteure und die Sichtbarkeit der Industriekultur auf Landes- und Bundesebene.
Frank Peuker, 1963 in Zittau geboren und aufgewachsen, arbeitete bis 1990 als Automechaniker und war ab Sommer 1989 aktiv im Neuen Forum, wechselte im August 1990 in die Stadtverwaltung Zittau, absolvierte die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten sowie ein berufsbegleitendes Studium zum Verwaltungs- und Betriebswirt (VWA).
Seit 2001 ist Frank Peuker hauptamtlicher Bürgermeister in Großschönau, mittlerweile in der 4. Wahlperiode. Nach den brachialen Umbrüchen 1989/90 galt es für die Gemeinde neue Perspektiven zu suchen. Auf Basis der einmaligen über 350jährigen Textiltradition wird – auch mit externer Begleitung, z.B. im bundesweiten EXWOST-Forschungsfeld „Großschönau 2030“ – seit 2009 die Marke „Textildorf“ entwickelt.
Frank Peuker engagiert sich seit 1990 in der Kommunalpolitik, war 30 Jahre Mitglied des Kreistages, ist Vorsitzender des Naturpark Zittauer Gebirge e. V., Mitglied in Vorständen von kommunalen Aufsichtsräten/ Zweckverbänden sowie Stiftungen.
Anja Nixdorf-Munkwitz ist ausgewiesene Expertin für Industriekultur und spezialisiert auf die Schwerpunkte Transformationsregionen in Ostdeutschland, professionelles Stiftungswesen, sowie Engagementkultur und Identität in Kultur und Zivilgesellschaft. Sie studierte „Kultur & Management“ (UNESCO-Modellstudiengang) und „Schutz Europäischen Kulturerbes“ (Europauniversität VIADRINA). Ihre Arbeitsschwerpunkte in der Industriekultur erschließt Anja Nixdorf-Munkwitz sowohl von der Handlungsebene des Kulturmanagements „Die Kunst Kultur möglich zu machen“, wie auch vom emotionalen Zugang der Zielgruppen.
Sie ist die Gründerin der Stiftung Kraftwerk Hirschfelde, lehrt zu den Bereichen Kulturmanagement, Stiftungswesen, Projektentwicklung. Aktuell ist der Strukturwandel der (Ober)Lausitz ihr berufliches Hauptfeld, im Ehrenamt ist sie Vorsitzende des Landesverbandes Industriekultur Sachsen e.V. Der regionalen Alltagskultur widmet sie sich als Kulinarik-Botschafterin und Vorstand von Slow Food Lausitz mit ihrem Vorhaben „Ein Korb voll Glück“. Seit 2025 Mitglied im erweiterten Vorstand des Bundesverband Industriekultur Deutschland BIKD.
PANEL 2
REGIONALE IDENTITÄT, WIRTSCHAFTLICHE UND KULTURELLE ENTWICKLUNG, TOURISMUS
Matthias Wießner, geboren 1966 in Leipzig, studierte nach der Wiedervereinigung Geschichte, Politikwissenschaft, Journalistik, Musikgeschichte und Urheberrecht an den Universitäten Leipzig, Basel, Freiburg und der HU Berlin. Ein DFG-Stipendium führte ihn an die Universität Bayreuth. Beruflich war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Leipzig und Saarbrücken tätig, im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig und war als Programm Direktor im Kunstkraftwerk Leipzig an der Revitalisierung des historischen Industriegebäudes beteiligt. Seit 2021 arbeitet er als E-Learning Experte bei Lecturio. Er hat Veröffentlichungen zur Kultur- und Rechtsgeschichte, insbes. zum Urheber- und Patentrecht der DDR und zur Leipziger Stadtgeschichte, vorgelegt.
Im Dez. 2024 wurde er zum 1. Vorsitzenden des Industriekultur Leipzig e.V. gewählt. In dieser Funktion vertritt er den Verein nach außen, verantwortet die inhaltliche und organisatorische Ausrichtung. Der Verein organisiert u. a. die Tage der Industriekultur Leipzig, die Verleihung des Karl-Heine-Preises, Ausstellungen, Vorträge und Führungen und einen Bestandskatalog der Industriedenkmale in Leipzig.
Sebastian Dämmler geboren 1992 in Zwickau, geprägt durch das Aufwachsen in den postsozialistischen Ruinenlandschaften der sächsischen Automobilstadt.
Seit über 15 Jahren reist er durch den Osten von Deutschland und dokumentiert Industriearchitekturen und die städtebaulichen Prägungen traditioneller Industriereviere im Spannungsfeld gesellschaftlicher Entwicklungen. In diversen Vereinen und Stiftungen kämpft er für den Erhalt bedeutsamer Baukultur und technischer Denkmäler.
Steve Ittershagen, geboren 1976, lebt mit seiner Familie in Freiberg, Sachsen. Nach dem Studium der Psychologie, Politikwissenschaft und Geschichte an der TU Dresden sammelte er wertvolle Erfahrungen im Sächsischen Staatsministerium des Inneren und als Referent im Deutschen Bundestag sowie als Mitglied der Geschäftsführung der Eisenbahn-Bau und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn GmbH. Seit 2021 ist er Geschäftsführer des Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.
In der Kommunalpolitik engagiert sich Ittershagen als stellvertretender Oberbürgermeister von Freiberg und Ortsvorsteher des Ortsteils Zug. Zudem ist er im Stadtrat und Kreistag aktiv und Mitglied mehrerer Aufsichtsräte und regionaler Gremien. Seine Mitgliedschaft in Vereinen wie der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft e.V. und dem Freiberger Altertumsverein e.V. unterstreicht seine Leidenschaft für die regionale Kultur.
Karsten Feucht 1965 in Stuttgart geboren, beschäftigt seit seinem Studium der Architektur, Regionalentwicklung und Soziologie die Frage, wie Raum durch Wahrnehmung und Kommunikation entsteht. Dafür hat er gemeinsam mit dem Künstler Rainer Düvell die Wahrnehmungswerkstatt® entwickelt. Auf dieser Grundlage entwickelt er Tourenkonzepte, Freiluftausstellungen und Kunst am Bau.
Er arbeitete in der Lausitz bei der IBA, baute das Kompetenzzentrum excursio auf und leitete das IBA-Studierhaus. Seit 2021 ist er Industriekulturmanager beim Berliner Zentrum Industriekultur (bzi).
PANEL 3
INNOVATION, TRANSFORMATION, ORTE DER ZUKUNFT, LAND DER IDEEN
Thies Schröder studierte Landschaftsplanung und ist Experte im Bereich Industriekultur, Landschaftsarchitektur, Städtebau und Regionalentwicklung. Er ist Inhaber des L&H Verlags, praktiziert Standortentwicklung per Event als Geschäftsführer der Ferropolis GmbH und als Leiter des Forum Rathenau e.V. sowie als Vorstand der Energieavantgarde Anhalt e.V. und Vizepräsident der IHK Halle-Dessau. Im März 2025 wurde Thies Schröder zum Stellv. Vorsitzenden des neu gegründeten Bundesverbandes Industriekultur BIKD gewählt
Christian Schlodder wurde kurz vor der Wende in Altdöbern in Südbrandenburg geboren. Geprägt von diesem Umfeld wuchs er in einer Region auf, die bis heute tief von Strukturwandel und Umbrüchen gekennzeichnet und Teil der eigenen Familienbiographie ist. Sein Vater war Bergmann im Tagebau Greifenhain, seine Mutter arbeitete als Sozialarbeiterin.
Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann und einem abgeschlossenen Ingenieurstudium baute er in Berlin eine Marketing-Agentur auf, die heute knapp 40 Mitarbeiter:innen beschäftigt. Parallel engagiert er sich in seiner ostdeutschen Heimat. Mit dem Projekt Lokatorium verfolgt er gemeinsam mit einem Team die Reaktivierung eines ehemaligen Brennereigeländes mit über 200-jähriger Geschichte im Ortskern von Altdöbern, das zu einem Ort für Kultur, Wirtschaft und Begegnung entwickelt werden soll. 2024 erschien zudem im KiWi-Verlag sein Buch über den Künstler Tex Brasket, den er während dessen Zeit als obdachlosen Straßenmusiker begleitete.
Constanze Roth, Kunsthistorikerin M.A., lebt in Jena, Thüringen. Nach ihrem Magister-Abschluss an der Friedrich-Schiller-Universität Jena sammelte sie wertvolle Erfahrungen im Kunsthandel, als Co-Kuratorin am Stadtmuseum Jena und Mitarbeiterin der Marketingabteilung des mehrfach preisgekrönten Erlebnismuseums „Porzellanwelten“ in der mittelalterlichen Leuchtenburg. Seit 2014 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem außeruniversitären Forschungsinstitut INNOVENT e.V.. Dort hat sich das Innovationsnetzwerk WIR!-Bündnis Vogtlandpioniere konzipiert und koordiniert mit einem kleinen Team mehr als 25 Forschungsprojekte zum Schutz alter Bauwerke in der strukturschwachen Region Vogtland. Im April 2025 wurde sie zur Beisitzerin im Vorstand des Bundesverbands Industriekultur e.V. gewählt. Darüber hinaus leitet sie seit 2014 das Forum Inn-O-Kultur – eine offene Plattform zum Schutz von Kunst- und Kulturgütern durch innovative Oberflächentechnik.
Constanze Roth engagiert sich ehrenamtlich für die Thüringer Sozio- und Industriekultur, etwa in der Alten Umspannhalle TRAFO in Jena, einem einzigartigen Ort für Konzerte, Kunst und Debatten zur Zeitgeschichte.
Katrin Hoffmann, M.A. ist seit 2004 Geschäftsführerin des Industrievereins Sachsen 1828 e.V., einem Netzwerk aus 130 sächsischen Industrieunternehmen, Dienstleistern sowie Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, das die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Sachsen vorantreibt. Zuvor sammelte sie internationale Erfahrungen in Barcelona und Santiago de Chile. Sie studierte Kommunikationswissenschaft, Psychologie und Romanistik an der TU Dresden sowie an der Sorbonne Nouvelle in Paris.
In ihrer Funktion engagiert sie sich für die enge Verbindung von Industrie, Wissenschaft und Kultur, treibt Projekte zur Fachkräftesicherung und zum Technologietransfer voran und setzt auf die Kooperation mit Startups und der Kreativwirtschaft. Seit 2021 ist sie zudem Vorstandsvorsitzende des Maker e.V. und Vorstandsmitglied im Landesverband Industriekultur Sachsen e.V. Mit Leidenschaft initiiert sie Projekte, die Innovation, Nachhaltigkeit und regionale Entwicklung verbinden.
Heidi Pinkepank ist geschäftsführende Gesellschafterin des Instituts für neue Industriekultur INIK GmbH mit Sitz in Cottbus. Sie studierte Landschaftsplanung an der FH Erfurt und der Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas in Litauen. 2010 folgte der Master of Arts in World Heritage Studies an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus.
Zwischen 2000 und 2011 war sie Projektpartnerin im Ingenieurbüro ARCADIS Consult GmbH in Erfurt, Rostock und Freiberg, arbeitete in Umweltbildungsprojekten im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, in Berlin und in Cottbus sowie bei ThINK – Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH in Jena. Seit 2012 ist Heidi im INIK und wurde 2024 zur Geschäftsführerin berufen. 2020/21 folgte eine Mitarbeit an der BTU im FB Planen in Industriefolgelandschaften. INIK ist Partner der Welterbeinitiative Tagebaufolgelandschaft Lausitz, der Kreativen Lausitz, des Sächsischen Landesverbandes und des Bundesverbandes Industriekultur.
AUSWERTUNG UND RESÜMEE
Dr. Kirsten Baumann geb. 1963 in Hannover, Kunsthistorikerin und Historikerin. Studium in Trier und Bochum, dort 2001 promoviert mit der Arbeit „Wortgefechte. Völkische und nationalsozialistische Kunstkritik 1927-1939“. Wiss. Praktika u.a. in Washington D.C. und Essen. 1997-2009 wiss. Mitarbeiterin, seit 2005 stv. Direktorin an der Stiftung Bauhaus Dessau. 2009-2013 Direktorin des Museums der Arbeit in Hamburg, 2010-11 auch Alleinvorstand der Stiftung Historische Museen Hamburg. 2013-2021 Direktorin des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte Schloss Gottorf in Schleswig. Ab 2021 stv. Direktorin, seit 2022 Direktorin der acht LWL-Museen für Industriekultur in Dortmund. Seit dem 1.4.2025 Vorstandsvorsitzende des neu gegründeten Bundesverbands Industriekultur Deutschland e.V.
Prof. Joseph Hoppe Studium der Geschichte, Pädagogik und Historischen Anthropologie in Marburg und Berlin. Lektor und Programmleitung in verschiedenen Verlagen. Seit 1984 am Deutschen Technikmuseum Berlin, Kurator und Projektleiter zahlreicher Ausstellungen zur Kulturgeschichte der Technik. 2008–2020 Vize-Direktor des Technikmuseums und Leiter des wissenschaftlichen Dienstes. Lehrtätigkeiten an der HU Berlin, zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge zur Historie von Berliner Industriekultur, Mediengeschichte sowie allgemeiner Museumspraxis.
Seit 2011 in Kooperation mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Mitbegründer und Aufbau des Kompetenzhubs Berliner Zentrum Industriekultur (bzi). Leitung des bzi zusammen mit Prof. Dr. Haffner (HTW Berlin). Seit 2025 Mitglied im erweiterten Vorstand des Bundesverband Industriekultur Deutschland BIKD.